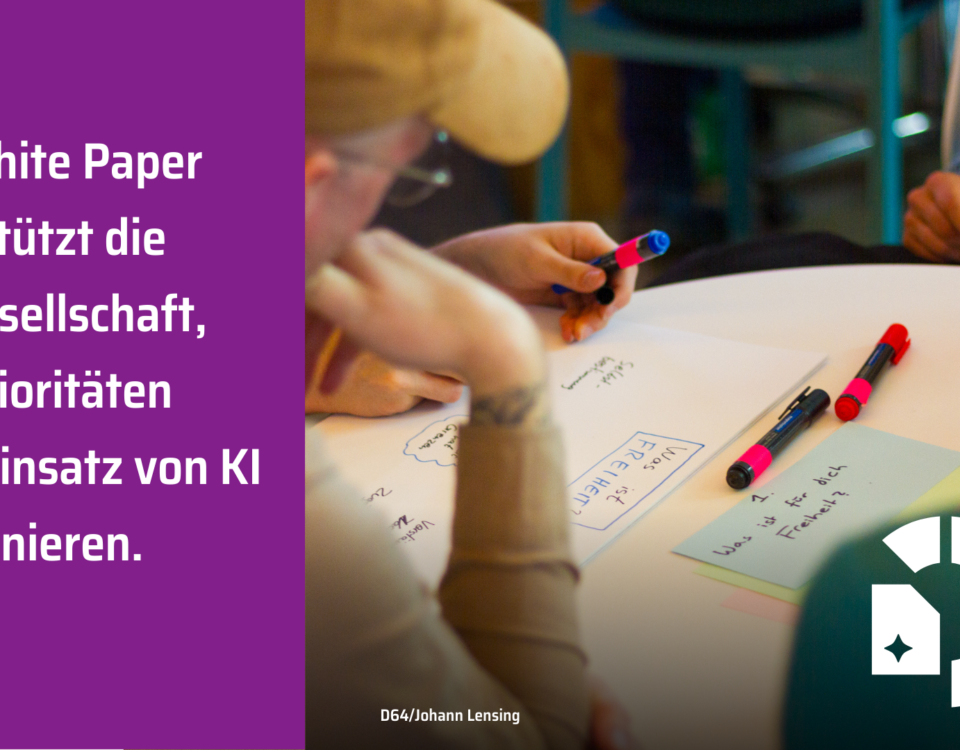Inhaltsverzeichnis
- 1. Hack irgendwas aber hack! Thema: Mission
- 2. Willkommen im Club. Thema: Vielfalt
- Wenn Sprache behindert statt befähigt
- Vielfältig inklusiv
- Der Fisch stinkt vom Kopf her
- 3. Unsexy und unauflösbar! Thema: Strukturen
- Mythos Grassroots
- Weiche Struktur vs. harte Struktur
- 4. Behörden, Wir müssen reden! Thema: Beziehungen
- Für, gegen oder mit? Beziehungen zu staatlichen Organen
- 5. Wie geht´s weiter?
Auf dem Brigades Congress, der letzten Herbst von Code for America ausgerichtet wurde, hatte ich die tolle Gelegenheit mich mit den US-amerikanischen Pendant der Open Knowledge Labs, den sogenannten Brigades auszutauschen. Im gleichen Monat gab es einen deutschlandweiten Workshop der Open Knowledge Lab Leads aus Deutschland. Die Resultate all dieser Gespräche und Sessions finden sich im Text unter den Punkten Mission, Vielfalt, Strukturen und Beziehungen wieder. Eine kleine Sammlung von Fragestellungen und Best-Practice-Beispiele habe ich unter die Punkte Herausforderungen und Tipps gepackt. Dies Notizen sind vornehmlich an Initiatoren von Gruppen bzw. Lab Leads gerichtet.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen danken, die maßgeblich zu diesen Gedanken und Tipps inspiriert haben.
1. Hack irgendwas aber hack! Thema: Mission
 An welchen Apps arbeitet das Lab gerade so?
An welchen Apps arbeitet das Lab gerade so?
Diese wohlwollende Frage wird immer wieder gestellt. Im Grunde ist eines der wichtigsten Ziele nicht Apps zu bauen, sondern einen Mentalitätswechsel unter den Bürger*innen und damit auch unter ihren gewählten Vertreter*innen voranzutreiben. Viele Probleme, die bearbeitet werden, sind eher kultureller denn technischer Natur. Keine einzige App oder Hack wird eine Änderung der Denkweise an sich bringen. Der Einsatz von Software kann schrittweise einen Wandel bewirken, die normative Kraft von Anwendungen wurde in der Vergangenheit vielfach über- und der nötige Kompetenzaufbau von “normalen” Bürgerinnen leider unterbewertet.
Civic Tech Communities haben den Anspruch gesellschaftlich wirksam zu sein. Deshalb setzen sich vornehmlich mit gesellschaftlichen Fragen auseinander, die sie mit ihren technologischen Kompetenzen praktisch bearbeiten. Das unterscheidet sie von anderen technikaffinen Gruppen. In vielerlei Hinsicht hat Technologie es sogar manchen Menschen erschwert Zugang zu Informationen und Diensten zu erhalten. Wenn zum Beispiel eine PDF heruntergeladen werden muss, um sie dann ausdrucken, zu unterschreiben, zu scannen und per E-Mail zurückgesandt werden muss, dann ist das ein komplexer Prozess. Es kann also nicht nur darum gehen einen fehlgeschlagenen Prozess zu digitalisieren, sondern auch um den Anspruch, die dahinter liegenden Strukturen zu ändern.
Wirkung statt Software!
Was wir als Civic Techie bzw. Ok Labs eigentlich bauen ist keine App, sondern eine Bewegung mit starken Kenntnissen von Code, Bürgerbeteiligungen, Verwaltungshandeln, Design und Vielem mehr. Wir bracuhen Menschen die Einfluss auf Richtlinien, Arbeitsweisen, Herangehensweisen und Beziehungen innerhalb von Staat und Gesellschaft nehmen wollen und können. In diesem Sinne könnte man sagen, dass Civic Tech eine Art des politischen Handelns ist.
Nicht jedes OK Lab sieht sich fähig oder gewillt den Staat zu hacken und das ist vollkommen okay so. Es ist meines Erachtens nicht sehr zielführend Civic Tech Communities in die Nähe von politischen Parteien zu stellen.
Ich persönlich betrachte Civic Tech Communities wie die OK Labs weniger als politischen Akteur, sondern vielmehr als Schnittstelle für bürgerschaftliches Engagement. Es ist eine Plattform für Menschen, deren Einstellung eine bestimmte Haltung gegenüber der Gesellschaft und Technik zugrunde liegt. Man könnte es vielleicht so formulieren: Nicht politisch im Sinne einer Partei – aber nie unpolitisch im Sinne einer verantwortungslosen Haltung. Die Bandbreite der Open-Themen fußt auf Bürger- und Menschenrechten. Auf Teilhabe, Inklusion, Akzeptanz und Vielem mehr. Das ist der Minimalkonsens. Menschen, die sich zum Beispiel für Open Data einsetzen und gleichzeitig mit menschenverachtenden Praktiken sympathisieren, sind kategorisch unerwünscht. Und das ist gut so.
Built with – not for
Beschränkt man Civic Tech darauf technische Projekte entwickeln zu lassen, die irgendwie gemeinwohlorientiert sind, ignoriert man einen zentralen Aspekt der eigentlich oberste Priorität genießen sollte: die Fokussierung auf nutzerzentriertes Design. Laurenellen McCann brachte es auf dem Code for America Summit 2014 auf den Punkt: „build with, not for“. Auch die USDS hält sich an dieses Prinzip: Die erste Regel ihres Handbuches besagt, „Verstehen, was die Menschen brauchen“.
Nutzerzentriertes Design kann auch in die Irre führen. In manchen Fällen kann dieses Rollenverständnis auch suboptimale Ergebnisse bringen. Das Verhältnis von Staat und Bürger unterscheidet sich von dem des Bereitstellers und des Nutzers. Bürgerzentriertes Design wäre ein Ansatz, der die Prinzipien benutzerorientiert Designs aufnimmt und sie um die Aspekten der Rolle des Staatsbürgers erweitert.
Civic Tech Labs sollten lernen mit Menschen zu arbeiten und nicht für sie. Echte Probleme lösen wir indem wir mit den Menschen zusammenarbeiten, die von diesen Problemen betroffen sind. Das sind in der Regel eben nicht die, denen wir in unserem täglichen Leben begegnen. Die einfachste Mission kann lauten: Wir bieten einen Raum, in dem sich Menschen versammeln, lernen und Technik für Bürgerinnen entwickeln können. Analog und digital.
2. Willkommen im Club. Thema: Vielfalt

Wenn wir Software konzipieren, die irgendwas mit Bürgerbeteiligung zu tun hat, dann scheint es einleuchtend, dass wir uns auch mit gesellschaftlichen Dynamiken auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel mit Mechanismen von Nichtbeteiligung, Ausgrenzung und Stigmatisierung.
Es liegt in der Natur der Sache, dass besonders erfolgreiche Personen keinen Anlass verspüren, Bedingungen zu ändern, von denen sie profitieren und mit denen sie bisher gut zurechtgekommen sind. Deshalb fällt es vielen auch nicht leicht über Rassismus zu sprechen. Es ist leider weitaus schwieriger soziale Zusammenhänge zu hacken als die Wahlsoftware in Deutschland. Die Sprache konstituierte die Gesellschaft – warum also nicht die Sprache hacken um gesellschaftliche Zusammenhänge zu ändern?
Wenn Sprache behindert statt befähigt
Jeder Mensch ist zugleich der Nutznießer und das Opfer der sprachlichen Tradition in die er hineingeboren wurde. Ein Nutznießer weil die Sprache ihm Zugang zu den gespeicherten Informationen aus Erfahrungen anderer Menschen gewährt. Ein Opfer weil die Sprache ihn in dem Glauben bestärkt, das ihm so vermittelte Bewusstsein sei das einzig Mögliche und Wahre. Er wird deshalb bereit sein, seine Begriffssysteme (z.B. von Herkunft und Geschlecht) für gegebene Tatbestände, seine Bezeichnungen für die Dinge selbst zu halten: Es ist so – weil es so heißt.
Oft fehlen uns die Fähigkeiten für nuancierte Gespräche, deshalb tun wir so als wären sie nicht notwendig. Wenn wir nicht ausweichen können lenken wir ab oder wir regen uns auf, sind sprachlos und reagieren dünnhäutig, wenn unser Wort anderen nicht zu passen scheinen. Um unsere Unzulänglichkeiten abzumildern, benutzen wir tröstende oder neutral klingende Wörter, die nicht mit dem Finger auf uns zeigen. Manches Wort fühlt sich ausgesprochen zu direkt an und verweist dabei meist auf eine unbequeme Tatsache.
Ein Brigade-Member formulierte es so: „Wenn ich mich nicht unwohl fühle, dann bin ich Teil des Problems”. Das heißt, wenn ich weiß bin und mich nicht regelmäßig unwohl fühle, wenn ich sehe wie meine Mitmenschen tagtäglich durch systemischen und strukturellen Rassismus behandelt werden – besonders veranschaulicht durch unser aktuelles politisches Umfeld -, dann bin ich wahrscheinlich ein Teil dieses gesamten Systems und des Problems.“ Das „Weiß-Sein“ steht dabei stellvertretend für eine Reihe weiterer Attribute die in diesem Zusammenhang von Benachteiligung und Diskriminierung eine Rolle spielen können.
Vielfältig inklusiv
Das ehemals neutrale Wort „Vielfalt“, das eigentlich eine Gruppe beschreiben sollte, aber nun zur Beschreibung eines einzelnen Menschen dient, wird inzwischen eher mit einer Senkung der Messlatte assoziiert. Nach der Gleichung: Vielfalt = Person der Farbe XY oder Frau = niedrige Fähigkeit oder nicht verschieden = weißer Mann = hohe Fähigkeit. Den Referenzpunkt bildet dann der letzte Part und damit die Norm. Ebenso geht es mir mit dem Begriff Inklusion. Was mich an „Inklusion“ stört ist, dass es sich wie ein neutrales Wort anhört, es aber nicht ist! Es stellt sich hier die Frage: Wer schließt wen mit ein? Es klingt eher wie ein Akt der Aufnahme oder Absorption. Dabei soll Inklusion eigentlich bedeuten exkludierende Umstände beseitigen und Anderen nicht das eigene Label auf die Stirn zu kleben.
Um es einfach auszudrücken: Toleranz ist wenn ich eine andere Person aushalte, Akzeptanz wenn ich ihre Anwesenheit als in Ordnung betrachte. Ich kann die Vielfalt vergrößern, indem ich die Person zu meiner Party einlade, aber Inklusion findet erst statt, wenn ich sie zum Tanzen auffordere.
Die erfolgreichsten Projekte kommen von Teams mit unterschiedlichsten Kompetenzen. Vielfalt macht stark! Selbst wenn ich überzeugt wäre, dass Vielfalt „schwächt“, würde ich sie dennoch für eine erstrebenswerte Eigenschaft von Gesellschaften halten. Vielfalt kann als Ressource betrachtet werden und nicht als nett gemeinte Handlungsmaxime. Wir brauchen Vielfalt einfach, um erfolgreich zu sein. Vielfalt jedoch nur aus der Perspektive der Nützlichkeit zu betrachten ist verachtend: Menschen existierten zu keinem Zweck, sondern sind einfach da, ganz egal wie nützlich sie sind.
Der Fisch stinkt vom Kopf her
Es gibt immer mindestens eine Person, die den Raum bei einem Meeting sprichwörtlich öffnet und ihn mit einer bestimmten Bedeutung füllt. Ganz egal, ob es der Person bewusst ist oder nicht. Diese Person führt diesen Raum eine gewisse Zeit. Und ihre Art der Führung beeinflusst maßgeblich, wer sich angesprochen fühlt und den Raum letztendlich betritt.
Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Ansprüche. Es kann keine universelle Checkliste geben, die es nur abzuarbeiten gilt, um eine offene und inklusive Kultur zu schaffen – sehr wohl aber Ansätze und Einstellungen um Menschen, die einem nicht ähnlich sind, die Teilnahme zu erleichtern. Es ist meistens nicht einfach an die passenden Räumlichkeiten zu kommen, und noch schwieriger sie nach eigenen Wünschen zu gestalten. Manchmal genügen einige winzige Änderungen damit sich Menschen wohlfühlen und beteiligen.
Herausforderungen:
- Viele Communities spiegeln nicht die Gemeinschaften wieder, die am meisten Hilfe benötigen. Wie schaffen wir es unsere Labs vielfältiger und inklusiver zu gestalten?
- Wie können wir unsere Sprache weiterentwickeln, um Beteiligung zu fördern und niemanden unbewusst auszuschließen?
Tipps:
- Wenn Ihr möchtet, dass vermehrt Menschen mit den Attributen XY zu Euch kommen, dann lasst sie Meetups oder Projekte leiten.
- Stellt neuen Menschen eine Aktivität oder ein Projekt zur Verfügung, damit sie ihre Fähigkeiten beweisen und an dem Projekt wachsen.
- Nicht-Techies können bei der Unterstützung von Veranstaltungen helfen und langsam in die Community hineinwachsen. Sie sind manchmal ideale Sprachrohre nach außen, weil sie einen anderen Blickwinkel haben als die “Insider”.
- Ladet Vertreterinnen anderer sympathischer Gruppen oder Vereine ein, um verschiedene Typen von Leuten mit einzubeziehen.
- Gebt kleine Anreize für die Teilnahme an Konferenzen,insbesondere denjenigen, denen Ihr seltener auf solchen begegnet. Überlegt gemeinsam welche Aufgaben sie bei Euren Veranstaltungen übernehmen können.
- Achtet bei der Kommunikation Eure Entscheidung darauf, dass Ihr die Person nicht deshalb aussucht weil sie eine Frau ist, sondern weil sie es kann. Auch wenn es vielleicht ausschlaggebend war, dass sie eine Frau ist. Logisch macht das keinen Unterschied. Niemand möchte jedoch aufgrund eines „Minderheiten-Bonus” Almosen erhalten, vielmehr aufgrund seiner positiven Eigenschaften ausgesucht werden. Niemand fühlt sich in der Rolle des Quotenmenschens wohl.
- Fangt an zu zählen: Anhand von Daten lässt sich die Vielfalt besser wahrnehmen: “Wer ist da und wieviel davon?” oder “Wer spricht wie lange?”. Code for Chicago nutzen beispielsweise arementalkingtoomuch.com zur Messung von Redezeiten von Männern. Natürlich löst das Tool nicht das Problem. Schon gar nicht, wenn unerbittlich an irgendeiner Zahl festgehalten wird. Aber es kann Euch helfen, Eure Wahrnehmung zu schärfen. Benutzt es einfach mal.
- Subtile Hinweise können helfen: Beginnt Veranstaltungen, indem Ihr gezielt mit Pronomen (er, sie, es) spielt und so den Kreis der Angesprochenen erweitert! Es gibt viele verschiedene Arten alle anzusprechen: DesignerInnen, Designer*innen oder ihr benutzt konsequent weibliche Form und schaut, ob sich Männer angesprochen fühlen oder nicht. Spielt mit der Sprache ohne Anderen vorzugeben, was das einzig Richtige ist. So vermeidet ihr zerstörerische Wortgefechte der ewigen Besserwisser, die letztendlich eine toxische Stimmung verbreiten.
- Gemeinsame Codes wie Kleidung, Sprache, Symbole etc. stärken den inneren Zusammenhalt der Community , schaffen jedoch gleichzeitig auch Abgrenzung nach außen. Geht sorgsam mit Insider-Sprache und schwer zu verstehenden Begriffen oder Symbolen um. Haltet es etwas mainstreamiger als Euch vielleicht lieb ist. Nicht alle können so cool sein wie ihr. 🙂
- Veranstaltungsorte mit Barrierefreiheit! Prüft Eure Veranstaltungsort auf die mögliche Hindernisse wie fehlende Aufzüge oder unüberwindbare Hindernisse.
- Schaut Euch Eure Anziehungspunkte an: Fangt mit Euren Räumen, Leads und dem Essen an: Der Stereotyp der darauf anspricht könnte auch die Ursache dafür sein, weshalb andere Personenkreise nicht auftauchen. Zum Beispiel: Junge weiße Männer, die im dunklen Raum Bier trinken, Pizza essen und im Kreis sitzend in ordinärer Kumpelsprache kommunizieren. Böses Klischee, aber nicht weit hergeholt.
- Essen ist wichtiger als man zunächst vermutet: Viele Tech-Events finden während der Abendbrotzeit statt. Bietet kleine Snacks an. Wer dafür keine Mittel hat, kann sich evtl. mit lokalen Foodsharer-Gruppen vernetzen. Der Einstieg fällt leichter, wenn Menschen über Mahlzeiten reden und niemand hungrig oder nervös ist. Ein Abendessen zwischen 18.30 – 19.00 Uhr, bringt die Leute früh auf die Beine. Wenn sichtbar ist, dass geredet und nicht auf Computer gestarrt wird, senkt das die Hemmschwelle noch weiter.
- Gebt Einführungen, damit Neulinge und unsichere Interessierte leichter ihre Rolle finden. Weist darauf hin dass es einen Code of Conduct gibt und der Euch wichtig ist.
- Findet Organisatoren oder Moderatorinnen mit „hoher emotionaler Intelligenz“ die spüren, wenn die Teilnehmerinnen sich unwohl fühlen und auch eingreifen können. Das ist wichtiger als die größte Technikkompetenz.
- Es ist besser wenn die starken Kompetenzen und Führungsrollen nicht konzentriert werden, d.h. die Moderatorin sollte nicht gleichzeitig der Oberguru des besprochenen Themas sein. Verteilt diese Kräfte so gut es geht auf mehrere Personen.
- Chi Hack Night hat einen Slackbot, der immer wenn das Wort „Jungs“ fällt fragt: „Hast Du die Leute gemeint?“
- Was für die Community wichtig ist, sollte für die nicht-technischen Gruppen mit denen Ihr zusammenarbeiten wollt, bereits wichtig sein. Stellt ihnen die passenden Fragen zur Relevanz Eures Projektes!
- Testet Eure Konzepte mit Leuten, die nichts von dem verstehen was Ihr da gerade macht! Mit den richtigen Fragen erhaltet ihr mit Sicherheit tolle Antworten und neue Erkenntnisse.
- Zieht explizit Nicht-Entwicklergruppen mit ein: Code for Maine änderte den Namen der „Civic Hack Conference“ in „Civic Design Conference“ und konnte einen Anstieg der nicht-technischen Besucherzahlen beobachten.
- Wenn Ihr neue Leute sucht und schreibt: „Wir wollen einen UX-Designer“, versucht den Job mit anderenVokabeln zu beschreiben. Es fällt vielen Menschen schwerer sich mit der Rolle XY zu definieren, als von sich zu behaupten dieses oder jenes mal ausprobieren zu wollen. Schreibt stattdessen lieber „Liebst Du das Web?“ oder „Magst Du Farben?“ (das geht sicher noch etwas kreativer). Damit fühlen sich augenblicklich mehr Leute angesprochen.
3. Unsexy und unauflösbar! Thema: Strukturen

Gruppen, die eine selbstorganisierte organische Entwicklung ohne vorgezeichnete Wege erlauben, strahlen eine enorme Dynamik aus. Wer diese Dynamik mal erleben durfte, kennt die Anziehungskraft solcher Unternehmungen. Innerhalb kürzester Zeit kann Großes entstehen. Es macht zweifelsohne Spaß, informell und einfach mal drauf los zu arbeiten. Keine strikten Verpflichtungen einzuhalten oder Rechenschaft ablegen zu müssen. All das fördert Kreativität und gibt Gedanken den freien Raum, den viele Menschen in ihrem (Job-) Leben vermissen. Anfangs wird die Form strukturlosen Handelns von Allen geschätzt. Nach einer gewissen Zeit und Gruppengröße werden die gleichen Arten von Entscheidungen gefällt, und plötzlich fühlen sich manche auf die eine oder andere Weise genervt oder gar enttäuscht von der Gruppe. Die dynamische Strukturlosigkeit und das kreative Chaos kann seine Versprechen an die Gruppe ab diesem Punkt nicht mehr halten.
Die Idee der Strukturlosigkeit von Gruppen stellt eine nachvollziehbare Reaktion auf eine überstrukturierte Gesellschaft der 1960er dar, in der Misstrauen gegen Disziplin, Organisation und Hierarchie weit verbreitet war. Das ist heute nicht anders. Als Ideal politischen Handelns wird sie jedoch zu einem problematischen Selbstzweck. Die Erfahrung der Befreiung von der hierarchisch-patriarchalischen Top-Down-Organisationsstruktur und der Wunsch, dass irgendjemand irgendetwas tun kann ohne lange Entscheidungswege und Direktiven, ist nicht nur im Startup-Umfeld eine verlockende Vorstellung. Wenn informelle Gruppen aber so tun als ob dies organisatorisch in jeder Größenordnung funktionieren könnte, lassen sie implizite Hierarchien und Voreingenommenheit auf eine unausgesprochene, nicht weniger problematische Weise zu.
Mythos Grassroots
Es gibt in Grassroots-Gruppen oftmals Tendenzen, die eine Entwicklung formaler Strukturen, hierarchische Positionen und eine Institutionalisierung blockieren. Sie übersehen dabei aber die informellen Strukturen, die sich in jeder sozialen Gruppe auch und gerade ohne formelle Entscheidungswege einspielen. So wird Strukturlosigkeit zu einem Mittel, Macht zu maskieren. Strukturlosigkeit wird fälschlicherweise oft mit dem Fehlen von Hierarchien verwechselt, obwohl effektive, nicht-hierarchische Organisationsformen tatsächlich viel Struktur erfordern. Jeder, der an einer effektiv moderierten Generalversammlung oder einer Ratssitzung teilgenommen hat, wird diese Unterscheidung gut verstehen.
Weiche Struktur vs. harte Struktur
Kann sich eine Gruppe, die sich offensichtlich stark für das Thema Transparenz einsetzt, selber intransparente Wege der Entscheidungsfindung akzeptieren? Ich denke Ja. Die Voraussetzung dafür ist ein starkes Vertrauen innerhalb der Gruppe. Dieses Vertrauen kann eine Person nicht an beliebig viele Andere vergeben. Es kann innerhalb der Gruppe durchaus zielführend sein, dass ein schnelles und einfaches Handeln Vorrang vor beispielsweise der Informationspflicht aller Beteiligten genießt. Die Grundlage dafür ist das Einverständnis aller Beteiligter – nicht alleine der Mehrheit. Diese Struktur kann als “weich” betrachtet werden, da Prozesse undefiniert bleiben. Aber wenn die Gruppe in einem solchen Arrangement stecken bleibt und eine demokratische und partizipatorische Struktur möchte, dann ist das Schlüsselkonzept nicht die Hierarchie an sich, sondern die Rechenschaftspflicht. Dann ist eine “harte” Struktur nötig, die das Handeln eindeutig regelt. Informelle Ad-hoc-Strukturen können einfach funktionieren bis etwas schief geht. Dann ist die fehlende formale Struktur ein Problem.
Die “weiche“ Struktur kann bequem und energieeffizient sein aber ist meist nicht in der Lage, ernsthafte Probleme zu lösen. Die „harte“ Struktur kann zusätzliche Arbeiten bedeuten, aber sie wird vor allem dann wichtiger, sobald eine Gruppe wächst.
Diese Strukturen verbrauchen Ressourcen und können so viel Energie einfordern, dass die Gruppe ihre Ziele kaum mehr verfolgen kann. Was ist der Ausweg aus einer strukturlosen Organisation, die nicht richtig funktioniert? Das beste Mittel ist die Prävention: Klare Prozesse von Anfang an zu etablieren. Sobald sich eine Gruppe mit Arbeitscharakter gefunden hat gehören diese Themen zügig auf den Tisch.
Herausforderungen:
- Wie kann man neue Leute unterstützen, so dass sie von der Teilnahme an Meetups zur Arbeit an einem langfristigen Projekt übergehen?
- Neulinge beginnen oft mit sehr wenig Wissen über Civic Tech. Einführungen verschlingen oft Arbeitszeit – wie kann das Onboarding verbessert werden?
- Projektverzögerungen bremsen die Motivation.
- Einige wollen oder können sich nur kurzfristig engagieren.
- Fachexperten, erfahrene Programmierer, haben es manchmal es schwer technische Fertigkeiten zu vermitteln.
- Menschen kämpfen darum eine Aufgabe zu finden, die zu ihnen passt.
- Menschen, die lernen Code zu programmieren, wollen auch kleine ihrem Kenntnisstand entsprechenden Aufgaben.
- Wie baut man ein Kernteam auf, um langfristige Investitionen zu erleichtern?
- Freiwillige Helfer mit kleinen Kindern schaffen es manchmal nicht zu Treffen.
- GitHub kann eine Barriere sein. Was sind einfachere und populäre Alternativen?
- Manche Ideengeber wissen nicht immer wie man ein Projekt managt.
- Open Source ist ein führerloses Konzept – aber wie kann die nötige Führung zugelassen werden?
Tipps:
- Einige treffen sich wöchentlich, andere zweimal monatlich, wieder andere einmal monatlich. Wichtig ist: Regelmäßigkeit und der Spaß. Wer aus reinem Gruppenzwang zu Veranstaltungen kommt, hat kaum Interesse an längerfristiger Arbeit.
- Bildet Partnerschaft mit anderen Meetups oder Gruppen – hier kann viel Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden – achtet nur in der Außenkommunikation auf die jeweils richtige Marke , damit keine Unklarheiten entstehen wer angesprochen ist.
- Ein größeres Team, welches untereinander transparent arbeiten möchte, ist nicht automatisch schlagkräftiger.
- Schnelles, persönliches Onboarding. Wichtiger als alle Informationen abzuladen ist den Neuen schnell das Gefühl zu geben willkommen zu sein. Eine kurze Vorstellung ohne sich dabei zu wichtig zu nehmen bricht das Eis in der Regel. Fragen: Ist die Teilnehmerin neu in der Gegend, braucht er eine Einführung? Welche anderen Aktivitäten könnten sie interessieren?
- Um den Overhead beim Onboarding zu vermeiden können Gespräche auch bilateral geführt werden und nicht mit der gesamten Gruppe.
- Schreibt ein kleinees ABC für Civic Tech Neulinge, um das Onboarding leichter zu machen und das anderen Leads übergeben werden kann.
- Persönliche Verbindungen fördern – ja, Erwachsene sollten aufeinander zugehen können, fördert aber die Kontaktbildung indem ihr Menschen einander vorstellt und eine gemeinsame Leidenschaft aufzeigt.
- Trello ist einfacher für Nicht-Techniker als GitHub. Setzt nicht auf die Eurer Meinung nach technisch beste – sondern auf die am weitverbreitetste Lösung. Und ja, man kann Services von Google nutzen und Google stark kritisieren, ohne dabei die eigene Glaubwürdigkeit einzubüßen
- Struktur soll Chaos und Ziellosigkeit verhindern ist aber kein Selbstzweck – auch wenn ihr bisher ohne auskommt . Es ist es immer gut etwas Struktur in der Hinterhand zu haben, falls es ad hoc nicht funktioniert oder unübersichtlich wird.
- Balance zwischen Arbeitszeit und sozialer Zeit finden – im Zweifel ist letztere wichtiger.
- Die erfolgreichsten Projekte treffen sich auch außerhalb der regulären offenen Meetups, damit konzentriert gearbeitet werden kann und Neulinge nicht das Gefühl bekommen auf einer vielbefahrenen Kreuzung die Straße nicht überqueren zu können.
4. Behörden, Wir müssen reden! Thema: Beziehungen
 Wenn es in Deutschland in Sachen Civic Tech oft darum geht es besser zu machen als der Staat, geht es in den USA oft darum es überhaupt zu machen. Wo in Deutschland tendenziell staatliche Organe in die Verantwortung genommen werden, wenn es z.B. um soziale Dienste geht, liegen diese Aufgaben in den USA oft in den Händen von NGOs, Kirchen oder anderen privaten Initiativen. An dieser Stelle kann das hohe Maß an Selbstverantwortung dazu führen, selbst aktiv zu werden, statt auf den Staat zu warten. Mit allen positiven wie negativen gesellschaftlichen Folgen.
Wenn es in Deutschland in Sachen Civic Tech oft darum geht es besser zu machen als der Staat, geht es in den USA oft darum es überhaupt zu machen. Wo in Deutschland tendenziell staatliche Organe in die Verantwortung genommen werden, wenn es z.B. um soziale Dienste geht, liegen diese Aufgaben in den USA oft in den Händen von NGOs, Kirchen oder anderen privaten Initiativen. An dieser Stelle kann das hohe Maß an Selbstverantwortung dazu führen, selbst aktiv zu werden, statt auf den Staat zu warten. Mit allen positiven wie negativen gesellschaftlichen Folgen.
Für, gegen oder mit? Beziehungen zu staatlichen Organen
Es ist sehr schwierig zu sagen welche Art von Beziehung eine Civic-Tech-Community zu Behörden pflegen sollte. Sollen sie kollaborieren, um etwas Größeres auf die Beine zu stellen und dabei an kritischer Distanz einbüßen? Sollten sie sich als technische Opposition verstehen, die den Staat kritisch-konstruktiv beobachtet mit der hohen Wahrscheinlichkeit eher kleine Brötchen zu backen? Sollten sie sich einfach als Initiativen verstehen, die Leistungen erbringt, die aus ihrer Sicht sinnvoll sind?
Ich denke, alles davon ist richtig. Es hängt von dem jeweiligen Fall und den Beteiligten ab. Kooperationsbereitschaft sollte jedoch der Standardmodus sein. Auch in Interaktion mit den Behördenvertreterinnen. Dagegen kann dieser Modus wieder verlassen werden, wenn Schönwetter-Veranstaltungen und leere Versprechen Euch Zeit und Nerven rauben. Es sollte Vertretern von Behörden klar sein, dass sie mit Ehrenamtlichen arbeiten, die in ihrer Freizeit Leistungen liefern, die andere Akteure nur entgeltlich bereitstellen.
Herausforderungen:
- Wie kann man Beziehungen zwischen staatlicher Technologie und Regierung aufbauen, damit eine dauerhafte Zusammenarbeit stattfindet?
- Wie kann man die Beziehungen zu den Behörden aufrechterhalten, wenn sich die verantwortlichen Personen in Behörden und Initiativen ändern?
- Wie geht man mit misstrauischen Behörden um?
- Wie kann man auf Zuschüsse zugreifen, wenn keine normalen Haushaltsgelder von Behörden genutzt werden können?
Tipps:
- Stellt zuerst fest, ob Ihr die gleichen Ziele anstrebt und verfolgt. Bei Bedarf könnt Ihr Eure Ziele im Schwerpunkt anpassen bzw. ausrichten, um erfolgreicher in der Zusammenarbeit zu werden. Es ist einfacher an gemeinsamen und spezifischen Zielen zu arbeiten statt eine prinzipielle Zusammenarbeit zu beschließen.
- Manchmal geht es nicht darum die Lösung eines technischen Problems zu entwickeln, sondern eine gute Beschreibung des Problems, wie zum Beispiel es Code for Orlando gemacht haben: einer Kartierung (mit sogenannten Journey Maps) der Antragstellung für einen genehmigungspflichtigen Zaun. Die Stadt hat ihren die Türen geöffnet und war dankbar für die Arbeit der Brigade.
- Findet heraus, wer Euer Handeln toll findet – ganz egal aus welchem Bereich oder welcher Position diese Person stammt.
- Zeigt den Neugierigen, dass es in kurzer Zeit möglich ist andere technische oder designspezifische Lösungen zu finden, die machbar sind und innerhalb ihres Budgets liegen.
- Geht zunächst davon aus nicht zu verstehen wie die Organisation und ihr System funktioniert. An der Stelle müsst Ihr bereit sein mehr von der anderen Seite zu lernen als Euch vielleicht lieb ist.
- Zeigt Beispiele aus anderen Zusammenhänge wo Ähnliches realisiert wurde!
- Stochert nicht in Wunden herum – solange kein Vertrauen vorhanden ist, spricht niemand gerne über seine Schwächen. Oft kennen die Organisationen ihre Schwächen nicht einmal. Je vertikaler und größer eine Organisation aufgestellt ist, desto eher könnt ihr davon ausgehen, dass Vieles unerkannt und im Argen liegt.
- Organisiert regelmäßig Meetups und Roundtables, wenn es darum geht Beziehungen zu Partnern zu entwickeln, die möglicherweise irgendeine Art von deckungsgleichen Interessen mit Euch teilen. Die Termine sollten Monate im Voraus stehen um ein längerfristiges Interesse zu signalisieren.
- Nehmt direkten Kontakt mit Regierungs-Mitarbeiterinnen auf und organisiert Veranstaltungen, die etwas Besonderes für sie darstellen. Es müssen keine Dinnerpartys sein, aber Drink-and-Think-Veranstaltungen sind beziehungsfördernder als Emails mit rechthaberischen Inhalt.
- Wenn Menschen aus der öffentlichen Verwaltung mit Euch arbeiten sollen, dann schafft ihnen die Möglichkeit auch tatsächlich anders zu arbeiten als sie es gewohnt sind. Verdreht nicht die Augen, nur weil der Dienst XY auf der Arbeitsstelle gesperrt ist oder die Person sich nicht mit dem allerneuesten YZ auskennt.
- Eure Zeit ist besser angelegt, die Befürworter zu unterstützen, statt die Blockierer zu überzeugen. Nicht zuletzt weil Ihr über viel weniger Sitzfleisch verfügt als Euer Gegenüber.
- Fangt mit einem kleinen überschaubaren Projekt an. Je kleiner, desto besser. Ein minimaler und funktionierende Service oder ein fertiggestelltes Projekt mit echten Nutzen kann Türen öffnen und Vertrauen schaffen. Auch wenn das Projekt Eurer Techie-Peer-Group nur ein müdes Gähnen entlocken wird. Wichtig ist, dass es getan wird!
- Beginnt bei sehr scheuen und zurückhaltenden Behörden lieber mit “Schnarchdaten” als mit Transparenzprojekten wie Finanzdaten. Es fällt Behörden schwerer von einer geäußerten Position zu einem späteren Zeitpunkt Abstand zu nehmen, selbst wenn sie es als richtig erachten. Pflückt lieber die “tief hängenden Früchte” als ihnen die Revolution zu versprechen.
- Denkt daran: Fast egal was Ihr tut, Ihr werdet keine Revolution auslösen und mit einem Schlag eine Reihe von Probleme lösen, die Teil eines riesigen, trägen und undurchschaubaren Systems sind. Nach übersteigerter Hoffnung kommt der nüchterne Alltag und nicht selten auch Enttäuschung über all das, was man ändern wollte, aber nicht konnte. Tut Euch selber den Gefallen und bleibt auf den Teppich. Wenn ihr auch nur ein einziges reales (!) Problem löst, steht ihr auf dem Siegertreppchen und könnt Euch in Selbstzufriedenheit suhlen. Heldengeschichten sind eben auch nur Geschichten.
5. Wie geht´s weiter?

Ich bin überzeugt, dass Civic Tech jetzt und in Zukunft zu einer der wichtigsten Bereichen bürgerschaftlichen Engagements werden kann – manchmal auch ohne die Entwicklung und Auslieferung digitaler Produkte.
Civic Tech-Communities wie die Open Knowledge Labs können versuchen, dem Kontrollüberschuss von Wirtschaft und Staat mit Kompetenzaufbau für Bürgerinnen entgegenzutreten, gesellschaftlichen Wandel im Sinne einer Demokratiestärkung voranzutreiben und Experimentierräume für gemeinwohlorientierte Projekte zu schaffen. Analog wie digital.
Wenn Institutionen wie z.B. Universitäten oder Schulen nicht primär eine Stätte der wissenschaftlichen Forschung, sondern eine Sozialisationsagentur für die Heranführung des Nachwuchses an die komplexeren Fragen von Welt, Leben und Gesellschaft darstellen, können Civic Tech Communities das Vakuum zwischen den Themen Demokratie, Digitalisierung und informeller Wissensproduktionen füllen. Das können sie aber nicht alleine, jedoch immer in echter Zusammenarbeit mit denen, um die es geht (Bürger/Zielgruppe) und falls die Möglichkeit besteht mit denen (Staat), die die eigentliche Verantwortung dafür zu tragen hätten.
Ziel ist die Selbstbefähigung von Bürgern innerhalb der Zusammenhänge, die sie bereits jetzt und noch viel stärker in Zukunft massiv beeinflussen werden: die der digitalen Technologien und der dahinter liegenden Machtstrukturen. Das mag sich alles etwas anstrengend anhören – aber ehrlich gesagt macht es doch sehr viel Spaß! 🙂
Zum Weiterlesen empfehle ich das Paper von Laurenellen McCann, die ihre Arbeit zur Schaffung von bedarfs- und gemeinwohlorientierten (Bürger-) Technologien hier dokumentiert: -> Experimental Modes of Civic Engagement in Civic Tech (PDF).
Get it on!